zurück zur Übersicht der Artikel
Heinrich Scholz als Aphoristiker
Ein Fundstück von Friedemann Spicker
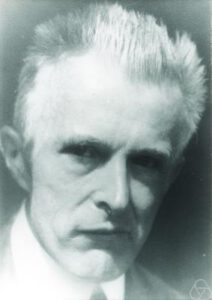
Heinrich Scholz im Math. Forschungsinstitut Oberwolfach. Bildquelle: Wikipedia
Der Theologe, Philosoph und Mathematiker Heinrich Scholz (17. 12. 1884 – 30. 12. 1956) hat als Lehrstuhlinhaber in drei Fächern nacheinander eine höchst ungewöhnliche Karriere gemacht, um erst mit Mitte fünfzig auch mit Aphorismen hervorzutreten. Seine Karriere beginnt er als Schüler des Theologen Adolf von Harnack und beendet sie als einer der frühen Pioniere der Entwicklung des Computers in Deutschland.
„Um uns zu treffen, braucht man nicht Schwerter, um uns zu erhellen, nicht Blitze zu reden.“ Blitze geschleudert und ‚mit Schwertern erhellt‘ hat er nicht in diesen Aphorismen. Nichts da von allem, was einen Großteil der Aphoristik ausmacht: pointierte Schärfe, blitzartige Überraschung, feurige Formulierung. Dennoch hat er ein umfangreiches aphoristisches Werk hinterlassen, das uns auch heute noch ‚treffen‘ kann. Es umfasst neben zahlreichen Veröffentlichungen in Zeitungen und Zeitschriften seit 1939 fünf schmale Hefte:
- Fragmente eines Platonikers. Köln: Staufen 1940 (Staufen-Bücherei 26).
- Zwischen den Zeiten. Tübingen, Stuttgart: Furche 1946.
- Von großen Menschen und Dingen. Berlin: Habel 1946.
- Zur Erhellung der Kunst und des Genies. Berlin: Habel 1947.
- Begegnung mit Nietzsche. Tübingen: Furche 1948.
Im Nachlass findet sich daneben reichliches Material, das für weitere Veröffentlichungen vorgesehen war, so drei Hefte „Sentenzen I-III“ (datiert 1946), ein Heft „Fragmente“ (datiert 1946/47), ein Manuskript „Fragmente um die menschlichen Dinge“ (1945), zwei Typoskripte „Maximen“ (September 1946, Mai 1953), ein Typoskript „Aphorismen über das Glück“ sowie eines „Vom Reden und vom Schweigen“ (beide Oktober 1946). Die Briefe lassen seine Stellung innerhalb des Aphorismus der frühen Bundesrepublik deutlicher werden.
Im Jahre 2022 bekam das Forschungsprojekt „Heinrich Scholz und die Schule von Münster. Mathematische Logik und Grundlagenforschung“ mehrere Millionen Euro aus dem bundesweiten Akademienprogramm zugewiesen, um eine digitale Edition vorzubereiten. In der Ankündigung heißt es:
„Heinrich Scholz gehörte zu den ungewöhnlichsten Intellektuellen seiner Zeit: Er war nach einander Professor für evangelische Theologie, Philosophie und Mathematische Logik. Der Wissenschaftler, der ab 1928 in Münster arbeitete, war überzeugt, dass sich Logik und Metaphysik ergänzen. Die von ihm initiierte Schule von Münster in der Mathematischen Logik und Grundlagenforschung strahlte bis in die Informatik aus.“
Unser Fundstück weist auf eine Auswahl voraus, die als dapha-drucke 14 in Vorbereitung ist:
Heinrich Scholz: Von großen Menschen und Dingen. Fragmente und Aphorismen. Mit einem einleitenden Essay herausgegeben von Friedemann Spicker. Unter Mitarbeit von Angelika Spicker-Wendt. Düsseldorf: Virgines.
Wenn sie Kapitel zusammenstellt wie:
- Fragmente um die menschlichen Dinge
- Maximen
- Vom Reden und vom Schweigen
- Aphorismen über das Glück
- Der Forscher
- Gedanken um den Philosophen
- Erfahrungen an Büchern
dann greift sie auf Scholz’ eigene Titel zurück. Als Fund- und Probierstück je zwei Aphorismen zu jedem Kapitel:
Man soll nichts Sonnenhaftes erwarten, wo man Drachenzähne gesät hat.
Man hilft dem Nichtswürdigen nicht, wenn man ihm den Gefallen erweist, sich von ihm zermürben zu lassen.
Man muss sehr reif zur Einsamkeit sein, um ein Wunder von ihr zu erwarten.
Man muss an sich selber zweifeln können, um sich vor Abenteuern zu hüten, denen man nicht gewachsen ist.
Alles Große muss vor die Frage gestellt werden dürfen, welche Opfer es angefordert hat.
Oder man nimmt das Große zu leicht.
Man weiß sehr viel von einem Menschen, wenn man weiß, welche Menschen und Dinge er groß nennt.
 Vom Unmöglichen soll man nicht sprechen, ohne sich daran zu erinnern, wie oft etwas wirklich geworden ist, was als unmöglich gegolten hat.
Vom Unmöglichen soll man nicht sprechen, ohne sich daran zu erinnern, wie oft etwas wirklich geworden ist, was als unmöglich gegolten hat.
Man soll niemanden anerkennen, der niemanden anerkennt.
Es gibt Menschen, die sprechen, weil sie etwas zu sagen haben, und Menschen, die sprechen, um sich reden zu hören.
Man wird nicht dadurch ein großer Mensch, dass man die großen Worte strapaziert.
Ein großer Mensch und ein kleines Glück, ein kleiner Mensch und ein großes Glück sind Dinge, die nicht zusammenpassen.
Ein Anruf des Glücks ist auch ein Appell. Wer sich nicht meldet, tut es auf seine Gefahr.
Je weniger ein Forscher von sich verlangt, um so schneller ist er bereit, aus einem Apperçu eine Theorie zu machen.
Alles Tatsächliche als solches ist stumm. Es spricht uns erst an, wenn es verstanden ist.
Eine Weisheit, die vor keiner Frage verstummt, ist genauso viel wert, wie ein Wunderdoktor, der jeden Patienten will heilen können.
Man hat einen merkwürdigen Begriff vom Denken, wenn man sich vorstellt, dass jemand sich an ein schärferes Denken gewöhnen kann, ohne ein anderer Mensch zu werden.
Kein Artist drückt sich umgestraft um den heiligen Ernst in der Kunst.
Keine Kritik ist zu scharf, wenn sie den Hochmut oder den Übermut trifft.
Übertreibung im Ausdruck verdirbt den Charakter.
Einfach zu schreiben kostet Zeit.
PS
Chat GPT weiß alles, aber nichts und sammelt deshalb Gemeinplätze:
„Insgesamt lässt sich sagen, dass Heinrich Scholz als Aphoristiker eine einzigartige Stimme in der deutschen Literatur darstellt […] ein herausragender Vertreter der Aphoristik, dessen Werke auch heute noch gelesen und geschätzt werden. Seine Fähigkeit, tiefgründige Gedanken in knappen Formulierungen auszudrücken, macht ihn zu einem zeitlosen Denker, dessen Werke auch in Zukunft Leser inspirieren werden.“
zurück zur Übersicht der Artikel


